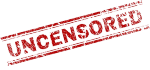Von 200 Millionen auf 3,8 Milliarden Euro: Das rote Wien und seine Neuverschuldung

3 Min.
In nur 25 Jahren schafften zwei Wiener Bürgermeister eine Explosion der Defizitzahlen – die Sozialausgaben steigen extrem, bei Investitionen wird kaum gebremst.
Seit dem Jahr 2000 hat sich Wiens öffentlicher Haushalt von einem vergleichsweise kleinen Kommunalhaushalt zu einem der größten Stadtetats in Europa entwickelt. Das Volumen des Doppelbudgets 2024/25 liegt bei 40 Milliarden Euro. Die Zahlen zeigen auch: Diese Ausgaben haben die Stadtkasse über Jahre unter Spannung versetzt und die Defizite und Schulden deutlich anwachsen lassen – die Höhe des jährlichen Budgetdefizits ist unter zwei Bürgermeistern um 3,6 Milliarden gestiegen.
Finanzpolitisch lässt sich die Periode in mehrere Phasen gliedern: Die Nullerjahre waren geprägt von fortdauernden Investitionen und einer Haushaltsführung, die administrative „Abgänge“ zuließ – im Jahr 2000 etwa wurde ein administrativer Abgang in Schilling-Höhe berichtet (umgerechnet etwa 200 Millionen Euro). Solche Abgänge blieben in den Folgejahren ein wiederkehrendes Steuerungsinstrument.
Die Finanzkrise 2008 und die Jahre danach markierten einen ersten, dauerhaften Wendepunkt: Die Stadt musste ihre Kreditaufnahmen deutlich erhöhen; der Rechnungshof dokumentierte einen starken Anstieg der Finanzschulden zwischen 2008 und 2012. Das vormals überschaubare Defizitprofil verwandelte sich in eine Periode höherer Neuverschuldung – trotz gleichzeitig hoher Investitionsquoten in Infrastruktur und Soziales.
Einen weiteren strukturellen Einschnitt brachte die Umstellung der städtischen Buchführung 2020: Wien führte ergebnis-, finanzierungs- und vermögensorientierte Haushalte ein und legte eine Eröffnungsbilanz vor. Das machte die Bilanz transparenter, offenbarte aber auch, dass Vermögenswerte, Rücklagen und Verbindlichkeiten anders zu beurteilen sind. Die Reform erhöhte kurzfristig die Sichtbarkeit von Belastungen, ohne die Politik der Investitionen grundsätzlich in Frage zu stellen.

Defizit stieg unter SPÖ-Bürgermeistern um 3,6 Milliarden Euro
Die Corona-Pandemie und ihre Nachwirkungen verschärften die Lage: Stützungen, Mindereinnahmen, erhöhte Sozialausgaben auch aufgrund einer unkontrollierten Massenzuwanderung und Energiepreisschocks ließen das Defizit- und Schuldenniveau erneut steigen. Zu den markanten Signalen: 2021/2022 kamen 1,3 Milliarden Euro an zusätzlicher Neuverschuldung hinzu; 2024 schloss Wien mit einem Abgang von etwa 1,77 Milliarden Euro ab – zwar besser als im ursprünglich budgetierten Worst-Case, jedoch dennoch historisch hoch. Und aktuell wird bestätigt, dass es 2025 zu einem Minus von 3,8 Milliarden kommt.
Wer trägt für diese Explosion der Außenstände politisch die Verantwortung? Über die Periode 2000 bis 2018 prägte Michael Häupl (SPÖ) die Finanzpolitik Wiens; seine Amtszeit war getragen von einer bewusst expansiven Investitionspolitik im Sozial- und Wohnungsbereich.
Seit Mai 2018 ist Michael Ludwig (SPÖ) Bürgermeister; unter seiner Verantwortung wurden Pandemie-Folgen gemanagt, das Doppelbudget 2024/25 beschlossen und Verschuldung sowie Investitionsprofile neu justiert. Die Kontinuität in der sozialdemokratisch dominierten Agenda erklärt, warum Wien immer wieder bewusst Defizite in Kauf nimmt, um Sozial- und Infrastrukturprogramme fortzuführen – und um mit einer Reduzierung der hohen Sozialleistungen auch für Nicht-Österreicher eine klare Fehlentwicklung einzugestehen.
Investitionen durch Neuverschuldung finanziert
Kritisch ist daran vor allem zweierlei: Erstens, die andauernde Praxis, Investitionen durch wiederkehrende Neuverschuldung zu finanzieren, verschiebt Kosten auf künftige Generationen und macht die Stadt anfälliger für Zins- und Konjunkturschwankungen. Zweitens fehlt bislang eine dauerhaft glaubwürdige, veröffentlichte Mittelfriststrategie mit klaren Konsolidierungsschritten – die Debatten im Gemeinderat zeigen, dass Oppositionsparteien regelmäßig härtere Sparvorgaben fordern, während die Stadtregierung auf Investitionen pocht.
Wien bleibt somit eine Stadt, die sich zu teure öffentliche Leistungen leistet. Doch die Kombination aus mit politischem Kalkül beschlossenen Zukunftsausgaben, strukturellen Buchungsänderungen seit 2020 und wiederkehrenden Krisen hat die Defizit- und Verschuldungsraten deutlich erhöht.
Entscheidend wird sein, ob die Stadtregierung es schafft, in den kommenden Jahren Investitionsdruck, Sozialverpflichtungen und die Notwendigkeit fiskalischer Konsolidierung in einen nachhaltigen Kompromiss zu bringen – ohne die soziale und stadtgestalterische Identität preiszugeben.
Credit: Getty Images
Credit: statement.at
ℹ️ Dieser Beitrag stammt ursprünglich von statement.at