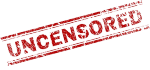Psychologe: „Junge linke Frauen sind weit mehr psychisch krank“

3 Min.
Die Zahl psychischer Erkrankungen nimmt weiter zu. Der Psychologe Holger Richter übt im Interview mit der Schweizer Tageszeitung Neue Zürcher Zeitung Kritik an der „Pathologisierung der Gesellschaft“ und macht „Wokeness“ mitverantwortlich für diesen Trend.
Der Psychologe Holger Richter sieht besonders junge linke Frauen als anfällig für psychische Störungen und spricht von einer „Pathologisierungswelle“, die durch den gesellschaftlichen Zeitgeist verstärkt werde: „Ja, junge linke Frauen sind weit häufiger psychisch krank als der vielgeschmähte alte weiße Mann“, erklärt Richter. „Es sind vor allem junge, woke linke Frauen, die eine Opferkultur pflegen und sich gegenseitig in der Opferrolle bestätigen“, betont der Psychologe.
Schwere Erkrankungen wie Schizophrenie oder Depressionen seien zwischen Männern und Frauen relativ gleich verteilt, erklärt Richter. Doch in der ambulanten Psychotherapie dominierten junge Frauen – mit „Diagnosen, die oft schwer zu fassen sind“: „Manchmal sind es sieben Diagnosen, die jemand bekommt“, so Richter. Diese Patienten verlangen mit ihren Störungen nach besonderer Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme: „Sie werten andere ab, die ihr Leiden infrage stellen“. Moderate rechte und konservative Menschen nehmen Leiden auch als Teil des Lebens wahr – aber nicht als Krankheit, so Richter.
„Diagnosen bieten eine neue Identität“
Nach Richters Analyse ersetzen psychische Diagnosen zunehmend traditionelle Identitäten: Früher prägten Staatszugehörigkeit, Religion oder familiäre Herkunft das Selbstbild. Heute bieten ADHS, Genderdysphorie oder Autismus eine neue Identität. Eine Diagnose verleihe vielen einen Opferstatus, erklärt Richter: „Wer eine Diagnose vorzuweisen hat, hat eine Erklärung, warum er dies und jenes nicht kann.“
Bestimmte Diagnosen nähmen stark zu: „Leute gehen zum Therapeuten und sagen: ‚Ich bin hochsensibel‘, ‚autistisch‘, ‚trans‘ oder ‚habe ADHS‘“, so Richter. Oft werde die Selbstwahrnehmung der Patienten unkritisch übernommen. Durch standardisierte Selbstauskunftsfragebögen diagnostizierten sich Patienten gewissermaßen selbst, indem sie lediglich ihre subjektiven Empfindungen ankreuzten. Die „Wokeness“ verstärke diese Entwicklung, indem sie Opfergruppen und Sensibilität in den Fokus rücke, erklärt der Psychologe. „Jeder erhält eine Diagnose, die sein Gefühl objektiviert – mit dem Stempel eines Therapeuten“, warnt er.
Natürlich sei es gut, dass psychische Erkrankungen ernst genommen werden, räumt Richter ein. „Aber das führt auch zu einer regelrechten Pathologisierungspandemie.“ Ein Blick auf die Zahlen verdeutliche den Trend: Bestimmte Diagnosen seien um mehrere tausend Prozent gestiegen. „Zurzeit studieren ungefähr 140.000 Studenten Psychologie in Deutschland – in den 1990er Jahren waren es 30.000. Jährlich kommen in Deutschland 2.000 neue Psychotherapiepraxen hinzu. Für Millennials und die Generation Z ist psychisches Leiden inzwischen Teil der Identitätsbildung.“
Politische Überzeugung hat Einfluss auf psychische Gesundheit
Richter sieht auch einen Zusammenhang zwischen politischer Überzeugung und psychischer Gesundheit: „Menschen, die glauben, Kontrolle über ihr Leben zu haben, geht es besser. Konservative Männer sagen eher: ‚Ich nehme mein Leben selbst in die Hand.‘ Scheitern sie, stehen sie wieder auf.“
Anders sei es im linken Spektrum: Hier überwiege die Haltung, dass der Staat, die Gesellschaft oder der Kapitalismus schuld sei. Frauen machten oft das Patriarchat verantwortlich. Das Gefühl der Machtlosigkeit führe zu psychischen Symptomen, erklärt der Psychologe. Gleichzeitig erlebten wir eine Gesellschaft, in der sich immer mehr Menschen über Diagnosen definieren – und in einer Opferrolle verharren.
Junge, weiche, linke Männer würden viel zu sehr in sich hineinhorchen, nicht arbeiten, bei ihren Eltern wohnen und jede gesellschaftliche Anforderung als Zumutung empfinden: „Denen rate ich, sich etwas von der Männlichkeit abzuschauen, die Ärmel hochzukrempeln, etwas anzupacken und so Selbstwirksamkeit zu erleben“, so Richter.
Keine Rechten mit einer Genderdysphorie
Auffällig sei zudem: „Ich kenne übrigens keine Rechten mit einer Genderdysphorie, die sich also im falschen Körper fühlen.“ Warum ist das so? „Konservative Menschen haben bereits eine gefestigte Identität – Religion, Geschlechtsrolle, Familie, Heimat“, so Richter. „Sie müssen niemanden beschuldigen, falsch benannt zu werden, weil sie im positiven Sinn narzisstisch in sich ruhen“, fügt er hinzu.
In vielen Ländern sei ein klarer Rechtsruck erkennbar, was auf ein Ende der „Wokeness“ hindeuten könnte. Auf die Frage, ob das eine Rückkehr zur Stigmatisierung psychisch Kranker bedeute, antwortet der Psychologe klar mit „Nein“: „Es wäre wünschenswert, wenn die Auswüchse der Pathologisierung vermehrt infrage gestellt würden und die Leute ihr Leben in die Hand nähmen. Wir müssen die wirklich psychisch Kranken aber weiterhin gut und effizient behandeln und ihnen möglichst Hilfe zur Selbsthilfe bieten.“
Psychologe: „Junge linke Frauen sind weit mehr psychisch krank“